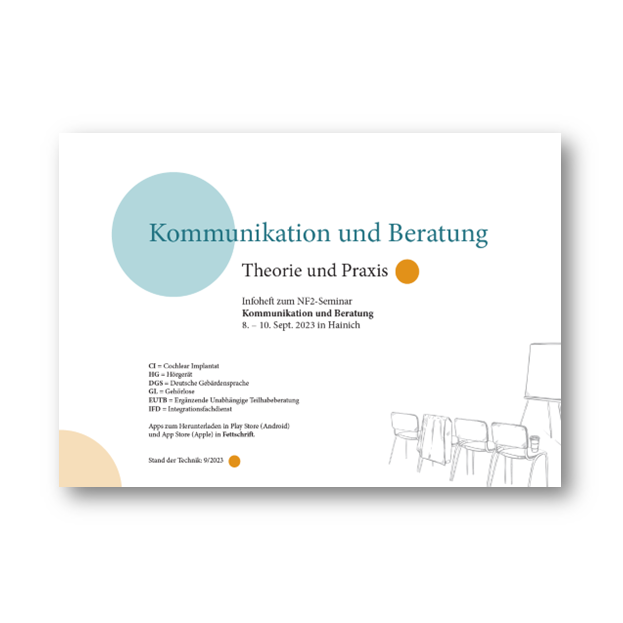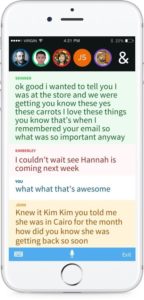Lippenablesen und Sprachpflege und Hörtraining für NF2-Patienten
(Von Angela Diehl, Hörgeschädigten-Sprachtherapeutin)
Eine Verbesserung der Lebensqualität, eine Hilfe zur Selbsthilfe, ein neuer Einstieg in die Kommunikation – das sind alles große Worte. Die Wünsche der NF2-Patienten sind jedoch viel einfacher zu beschreiben: Sie möchten besser verstehen und besser verstanden werden. Dazu können sie selbst eine ganze Menge tun. Leider ist der Weg dahin nicht ohne Anstrengung zu haben, auf der anderen Seite kann es aber sogar Spaß machen, die Kommunikationsfähigkeit erlebbar zu verbessern.
Das Problem: Die gestörte Kommunikationssituation
NF2-Betroffene sind generell von Ertaubung bedroht. Manche sind bereits vollständig taub, andere mehr oder weniger schwerhörig. Was das praktisch alles bedeutet, wissen die Betroffenen selbst am besten, können aber oft nicht gut genug damit umgehen. Ihr normal hörendes Umfeld hat keine Vorstellung davon, wie es ist, wenn man Sprache wenig oder gar nicht mehr versteht. Beides führt dazu, dass sich beide Seiten in der Kommunikationssituation ungewollt wechselseitig behindern. Um mit dem Umfeld anzufangen: Den wenigsten Menschen ist klar, wie sehr diese „unsichtbare Behinderung“ namens Hörverlust das Leben eines vormals hörenden Menschen verändert, wie die Schwierigkeiten der Kommunikation mit anderen alles, was bislang zu den gewöhnlichen Verrichtungen des Alltags und Berufslebens gehört hat, zu einem Hindernislauf machen und vor allem, wie sich sogar die Privatsphäre entwickelt, engere Bindungen entstehen, aber auch Kontakte die weniger werden oder ganz Abbrechen, weil die Kommunikation mühsamer geworden ist. Die geduldige Erläuterung der Situation eines spätertaubten oder schwerhörigen Menschen ist daher für seine Mitmenschen sehr wichtig und vernünftig. Die Beschreibung der konkreten Schwierigkeiten „öffnet“ auch dem uninformierten Gesprächspartner „die Augen“, macht ihm also klar, wo die Probleme liegen, wenn er sich beim Sprechen abwendet, so dass sein Mundbild nicht zu sehen ist, wenn er im dröhnenden Autoverkehr vor sich hin murmelt und wenn er seinen schwerhörigen Angehörigen von weitem und von hinten anruft.
Mit einer solchen Erklärung und der damit verbundenen Werbung um mehr Verständnis ist aber noch nicht alles geleistet. Manchmal führt ein Hinweis auf die Situation eines Hörgeschädigten sogar zu Reaktionen, die kontraproduktiv sind: Die wohlmeinend hilfreichen Mitmenschen werden z.B. unnötig laut und machen damit ein Verstehen eher schwieriger. Gut verständlich dagegen ist langsames und vor allem deutliches Sprechen, aber auch wiederum keine überdeutliche Artikulation. Es kann für die Hörgeschädigten sehr hilfreich sein, ihre Gesprächspartner zu "erziehen", ihnen also Verhaltensweisen nahezubringen, wie die Kommunikationsfähigkeit trotz Hörverlusts aufrechterhalten bleiben kann. Wer auf Verständnis trifft, kann seinen Mitmenschen viele Tipps dazu geben, wie unverständliche Gesprächsformen und Sprechgewohnheiten vermieden werden können. Eine ganz andere Sache ist die Entscheidung, rechtzeitig und vorbeugend ein Hörsprachtraining mit Lippenablesen in Angriff zu nehmen. Der Betroffene kann nämlich nicht nur sein Umfeld positiv beeinflussen, er hat es auch selbst in der Hand, seine Kommunikationsfähigkeit zu erweitern.
Man kann sehr viel tun, um die Verständigung, auf die es letztendlich ankommt, zu erleichtern und zu verbessern und sich damit auch das Leben in der sprechenden Umwelt um einiges leichter zu machen. Was man tun kann, soll deshalb in den folgenden drei Kapiteln erläutert werden. Nicht in Form von guten Ratschlägen – davon bekommt man ja sowieso meist genug. Stattdessen soll der Versuch gemacht werden, den Zusammenhang von Sprechen und Hören ein wenig zu verdeutlichen, sodass jeder für sich daraus die Schlüsse ziehen kann, die auf sein spezielles Verständigungsproblem zutreffen. Gezeigt werden soll auch, wie wichtig es ist, bei drohender Schwerhörigkeit oder Ertaubung präventiv zu arbeiten. Das bedeutet eben auch, mit Hörsprachtherapie und Lippenabsehen möglichst dann zu beginnen, wenn das Gehör noch intakt ist.
Erstes Kapitel:
Was kann eine Stimm- und Sprachpflege für den NF2-Patienten leisten?
Gut hörende Menschen lernen die Muttersprache durch Imitation. Kinder hören, was und wie die Mutter oder der Vater spricht, und sprechen das Gehörte nach. Jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass es selbstverständlich ist, als Kind die Muttersprache zu erlernen und zu sprechen, lange bevor man die erste Grammatikregel lernt. Bis auf die Leute, die sich beruflich mit Sprache befassen, weiß niemand, wie man ein [a] spricht - man spricht es, weil man es hört und man spricht es, wie man es hört. Wir lernen die Sprache jedoch nicht nur über das Hören, wir kontrollieren sie auch mit dem Gehör und wir passen unsere Sprache unserer Umgebung an. Wenn man einen stillen Raum betritt, senkt man automatisch seine Stimme, man spricht leiser oder flüstert sogar. Dieses Phänomen kennen die Meisten. Wenn man z.B. eine Kirche betritt, spricht man drinnen leiser als draußen vor dem Portal. Aber weniger bekannt ist, dass man auch tiefer spricht, dass man in diesen Situationen tatsächlich seine Stimme absenkt. Auf einer stark befahrenen Straße spricht man automatisch lauter. Wenn man sich durch Lärm bedingt selber nicht richtig hört, korrigiert man die Lautstärke entsprechend. Wenn nun aber diese Selbstkontrolle über das Gehör nicht mehr stattfinden kann, weil man sich nicht mehr hört, oder wenn die Kontrolle nur noch eingeschränkt stattfindet, weil man nicht mehr alles hört, dann verschlechtert sich in der Regel auch die Sprache. Es gibt also etwas wie eine gewohnheitsmäßige Verfestigung von Sprachmustern bei jedem Sprecher. Das ist Segen und Fluch zugleich: Es verweist auf das Moment der Übung, die mit jedem Sprechakt automatisch verbunden ist. Man muss demnach beim Sprechen nicht jedes Mal neu beginnen, sondern baut auf dem eigenen Erfahrungsschatz auf. Deshalb sind Sprachverbesserungen möglich und durch Übung auch haltbar zu machen. Das ist der Segen. Der Fluch ist das bleibende Handicap der Hörgeschädigten, die mangelnde automatische Selbstkontrolle: Einmal erworbene Sprechfehler, die nicht bemerkt werden, weil man sie gar nicht hört, verfestigen sich und sind, wenn sie nicht korrigiert werden, später nur schwer wieder rückgängig zu machen. Die einzige Möglichkeit für hörbehinderte SprecherInnen ist es daher, sich über die Sprache und über das eigene Sprechen Klarheit zu verschaffen, um den Hörverlust und damit auch den Kontrollverlust nach Möglichkeit kompensieren zu können.
Sprechprobleme bei Schwerhörigen oder Ertaubten
Die Veränderungen der Sprache, die entstehen können, wenn die auditive Kontrolle mangelhaft ist, sind vielfältig, lassen sich jedoch immer auf wenige wichtige Momente beim Sprechen, die jeder an sich selbst überprüfen kann zurückführen.
Luftführung und Zungenstellung
Diese beiden Artikulationsmomente sind besonders wichtig bei den stimmlosen Lauten wie zum Beispiel [f] und [s]. Man hört bei diesen Lauten nur die Reibung der Luft. Der Luftstrom wird geformt und je nach Zungen-, Zahn- und Lippenstellung verschieden an die Zähne geleitet und dort gebrochen. Dabei kommt es darauf an, dass alle beteiligten Sprechwerkzeuge (z.B. Zunge, Lippen, Kiefer) richtig zusammenarbeiten. Die Veränderungen, die dabei entstehen können, kann man selbst ausprobieren, wenn man ein [s] spricht und dabei nur ein wenig mit der Zunge spielt. Wird die Zunge auch nur ein bisschen nach hinten verschoben, ist ein „sch“ oder „ch“ zu hören. Wenn man es selbst nicht hört, muss eine zweite Person als hörende Testperson her. Viele Menschen, die eine leichte Altersschwerhörigkeit haben, können diese feinen Unterschiede nicht mehr wahrnehmen. Das [s] ist besonders problematisch. Bei Patienten, die im Hochtonbereich Hörprobleme haben, verschlechtert es sich häufig. Ein Beispiel dafür ist eine veränderte Zungenstellung: Wenn die Zungenspitze nur leicht an den vorderen Schneidezähnen anstößt, erklingt das [s] „gelispelt“. Oft verändert sich auch die Stärke des Luftstroms. Die Luftreibung wird schwach, so dass diese Laute im Verhältnis zu den stimmhaften Lauten zu leise gesprochen werden und so im Wort „untergehen“. Die Stellung der Zunge ist aber auch bei den stimmhaften Lauten sehr wichtig. Die Lautunterscheidung zwischen [o] und [ö], [u] und [ü] ist dafür ein gutes Beispiel. Wird die Zunge nicht genug oder nicht im richtigen Winkel angehoben, so klingen die Umlaute verwaschen oder verschwinden ganz. In den meisten Fällen finden solche Veränderungen relativ unmerklich statt. Die Sprechpartner, die täglich um einen sind, merken oft gar nicht, dass sich etwas verändert, weil man sich „einhört“ und den Freund oder Ehepartner nach wie vor versteht. Sie fragen allenfalls häufiger nach oder beschweren sich auch mal über „schlampige Aussprache“. Fremde Gesprächspartner dagegen haben unter Umständen große Schwierigkeiten, den Sprecher noch gut zu verstehen, geben aber in der Regel schon aus Höflichkeit keine Rückmeldung. Meist fällt es dem Schwerhörigen selbst auf, dass nicht nur er selbst oft nachfragen muss, weil er etwas nicht oder nicht gut verstanden hat, sondern dass auch die Gesprächspartner anscheinend Verständnisprobleme haben.
Die Stimmgebung
Die Stimmproduktion ist bei NF2-Betroffenen ein besonderes Problem. Viele von ihnen klagen über Stimmermüdung oder Heiserkeit. Wenn bei einer Operation die Stimmbänder verletzt oder gelähmt werden, ist eine richtige Stimmgebung gar nicht mehr ohne weiteres möglich. Aber man kann durch gezieltes Training Verbesserungen erzielen, ja sogar erreichen, dass ein gesund gebliebenes Stimmband zum Teil die Funktion des anderen mit übernimmt. Wie ein Sportler seine Muskeln trainieren kann und muss, so kann auch ein Sänger seine Stimmbänder trainieren. Nun sollen Hörgeschädigte ja keine Opern singen, aber sie können von den Erfahrungen der Profis durchaus profitieren. Eine weiche „angenehme“ Stimme ist nun einmal auch besser verständlich und vor allem auch für den Sprecher selber wohltuender als eine „kratzige“ Stimme mit hohen Luftanteilen. Fehler bei der Stimmbildung strengen in der Regel sehr an. Das führt dann auch dazu, dass man immer leiser spricht oder sogar das Sprechen möglichst vermeidet - und so das nötige „Stimmtraining“ immer weniger wird und sich die Stimme dadurch weiter verschlechtert – ein Teufelskreis, den es unbedingt zu vermeiden gilt.
Stimmlage und Tonhöhe
Mit der Stimme unterscheidet der Sprecher aber nicht nur Laute voneinander. Man gibt dem Gesagten eine Bedeutung. Das kennt auch jeder aus eigener Erfahrung, von sich und anderen: Wenn man wütend ist, fängt man leicht an zu schreien. Wenn man aufgeregt ist, klettert die Stimme automatisch in die Höhe, aber auch bei einer Frage. Menschen geben anderen durch ihre „Stimmung“ ihre Gefühle zu erkennen und sie erkennen selbst auch am Tonfall Stimmungslagen: Wut, Ärger, Trauer oder Freude. Ob man will oder nicht, Gefühle und Gedanken werden anderen mittels der Variationen mitgeteilt, die die menschliche Stimme bietet. Von Geburt an taube Menschen können sich das nicht vorstellen und können es deshalb auch nicht gut nachempfinden und in ihre Sprache aufnehmen, Spätertaubte müssen sich erinnern, wie es sich angehört hat, wenn ihnen zum Beispiel eine Frage gestellt wurde. Schon allein die Vorstellung, wie eine Frage klingt, ist nach der Ertaubung schwer ins Gedächtnis zu rufen, wenn man als (noch) Hörender keine bewusste Erfahrung mit Intonation und Satzmelodie gemacht hat. Noch viel schwieriger ist es, diesen Tonfall selbst wieder zu produzieren. Wenn man es nicht mehr hört, kann man ja auch nicht einfach die Beispielfrage imitieren, die der wohlmeinende Therapeut einem vorspricht. Die Aufforderung: „Heben Sie die Stimme an!“ ist für guthörende Menschen kein Problem. Auch wenn sie keinerlei Erfahrungen mit Musik und Tönen haben, können sie tiefe und hohe Töne produzieren, wenn man es ihnen vormacht. Für einen ertaubten Menschen ist das nur dann einigermaßen nachvollziehbar, wenn er noch als Hörender Erfahrungen mit der eigenen Stimme gemacht hat, also bewusst mit seiner Stimme umzugehen gelernt hat. Gerade deshalb ist eine präventive Sprach- und Stimmpflege so wichtig. Wer damit rechnen muss, dass eine Taubheit eintreten könnte, sollte rechtzeitig Vorsorge treffen, um die eigenen Sprachfertigkeiten zu sichern. Wort- und Satzbetonung Jeder gesprochene Satz hat eine Melodie, wie ein Lied. Dialekte unterscheiden sich nicht nur durch die Aussprache einzelner Wörter, sondern auch durch eine ganz eigene Satzmelodie. So erkennt zum Beispiel ein Deutscher einen Schweizer zuallererst daran, wie er „singt“, noch lange bevor er Differenzen bei den Einzellauten bemerkt. Diese Satzmelodie verändert sich, wenn man sie nicht mehr bei sich und anderen (bewusst oder unbewusst) wahrnimmt. Die Sprache wird „monoton“, d.h. sie verläuft nicht mehr in Höhen und Tiefen ähnlich einer Kurve, sondern eher in einer Linie — so dass sie auf den Zuhörer „ermüdend“ wirkt. Die feinen Differenzen, die das Sprechen auszeichnen, fallen in dieser Sprechweise weg. Dabei ist eine lebhafte Spreche wichtig für das Verstehen. Allein durch die unterschiedliche Betonung kann ein Satz verschiedene Bedeutungen bekommen, wie das folgende Beispiel mit den Hervorhebungen in der Schrift zeigt:
- Hast du mich verstanden?
- Hast du mich verstanden?
- Hast du mich verstanden?
Wer sich mit Sprache auskennt, kann auch besser sprechen
Schwerhörige oder ertaubte SprecherInnen sind nicht oder nur begrenzt in der Lage, die Defizite, die eine geringe Stimmgebung, eine fehlerhafte Luftführung oder Zungenstellung, eine zu hohe oder zu tiefe Stimmlage oder eine mangelhafte Betonung in der Aussprache verursacht, allein zu korrigieren. Je früher sich ein Betroffener um professionelle Hilfe bemüht, desto besser. Das Ziel einer Sprachpflege ist es immer, dass die hörbehinderte Person besser von anderen verstanden wird. Dazu muss sie wissen, was sie selbst tun kann, damit andere müheloser, entspannter und besser mit ihr kommunizieren können. Sie schafft dadurch für seine GesprächspartnerInnen eine angenehme Atmosphäre, ein Gesprächsklima, in dem sich beide, SprecherIn und AnsprechpartnerIn, wohlfühlen können. Die andere Seite in diesem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis von Sprechen und Hören ist es, dass man als hörgeschädigte Person die Gesprächspartner besser verstehen können soll. Davon handelt des nächste Kapitel.
Zweites Kapitel:
Absehen oder Lippenablesen ist eine Kunst, die jeder erlernen kann
Kann man denn „von den Lippen ablesen“? So einfach ist es leider nicht. Man kann nicht von den Lippen lesen, als habe man ein Buch vor sich. Eigentlich ist das auch unschwer einzusehen. Unsere Sprache spielt sich ja nun einmal nicht nur auf den Lippen ab. Die erste und wichtigste Einsicht ist deshalb: Man kann nur dort etwas „absehen“, wo es etwas zum Absehen gibt.
Das richtige Umfeld herstellen
Das betrifft erstens die Verhältnisse, in denen sich der Sprecher und der Absehende befinden. Wenn der Sprecher oder die Sprecherin so positioniert ist, dass das Licht auf das Gesicht fällt, kann man die Gesichtszüge relativ genau erkennen. Sobald die Person ihren Standort wechselt und beispielsweise zum Fenster geht, ist das Gesicht im Schatten und man sieht den Mund nur noch sehr undeutlich. Ähnlich ist es, wenn der Sprecher zu weit entfernt steht oder einen von der Seite anspricht. Zweitens sind alle Umstände störend, die das Mundbild verdecken, wie z. B. ein Bart oder wenn jemand während des Sprechens raucht. Drittens sprechen viele Leute so, dass sie die „Zähne nicht auseinander bekommen“, sie zeigen Ihrem Gegenüber nicht, was sich hinter den Zähnen abspielt - und das ist eine ganze Menge.
Diese Umstände kann man für sich selbst verbessern, indem man seine Gesprächspartner „erzieht“. Wenn man ihnen erklärt, dass man darauf angewiesen ist, vom Mund abzusehen und dass deutliches Sprechen hilfreich ist, sind viele Gesprächspartner sogar dankbar für diesen Hinweis. Aber, und das wissen die meisten Schwerhörigen aus eigener Erfahrung, auch wenn die Einsicht vorhanden ist, haben die Bemühungen der so angesprochenen Gesprächsteilnehmer ihre Grenzen. Vor allem muss man damit rechnen, dass ein „schlampiger“ Sprecher sich in den seltensten Fällen wirklich umstellen kann.
Was bedeutet „Absehen“?
Aber - und darauf kommt es vor allem an - selbst wenn alle Bedingungen optimal sind und der Sprecher ein sehr gutes Mundbild hat: Man kann von den Lippen nicht „lesen“. In der wissenschaftlichen Literatur findet sich immer wieder die Behauptung, dass 9-12 Laute gut absehbar seien, und das wäre ja bei 26 Lauten schon eine ganze Menge. Aber das ist leider nicht ganz richtig. Im Zuge der langjährigen theoretischen und praktischen Erfahrung mit dem Absehen in unserer Institution hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich keinen einzigen Laut gibt, den man eindeutig erkennen kann. Soviel zu den Grenzen des Absehens, die man sich und vor allem auch anderen bewusst machen sollte.
Nun aber zu den Chancen und Möglichkeiten, die das Erlernen bzw. Verbessern der Absehfähigkeit bietet. Wenn man die Mundbewegungen seiner Gesprächspartner verfolgt, kann man sehr viel erkennen. Man muss nur lernen, die Informationen, die einem geboten werden, richtig zu deuten. Damit ist die Theorie des Absehens angesprochen. Es geht um „Mundbildgleichheiten“ und die dadurch existierenden „Verwechslungsmöglichkeiten“ der Laute. Einfach ausgedrückt bedeutet das, dass ein Mundbild verschiedenen Lauten zugeordnet werden kann. Wenn man sieht, dass sich der Mund schließt, dann kann das bedeuten, dass der Gesprächspartner ein [m] spricht. Es kann aber, wie bereits beschrieben, ebenso ein [b] oder ein [p] sein. Oder es kann sich um eine Sprechpause handeln - der andere schließt einfach den Mund und hält ihn für einen Moment. Wenn man diese Möglichkeiten kennt, kann man auch mit diesem Wissen umgehen. Man baut diese Erkenntnis in seine Absehpraxis ein, und dann sieht man das Wort „Mutter“ und weiß gleichzeitig, dass es sich vielleicht auch um „Butter“ handeln könnte.
An dieser Stelle gibt es häufig den Einwand: „Was soll denn die ganze Theorie! Es gibt doch so viele Verwechslungsmöglichkeiten, und bis ich überlegt habe, welche davon in der speziellen Gesprächssituation in Frage kommen, ist nicht nur das Wort, sondern schon der ganze Satz vorbei. Das dauert doch viel zu lange.“ Aber das stimmt so nicht. Man braucht sich nur einmal daran zu erinnern, wie man das Autofahren gelernt hat. Was musste man sich alles einprägen! Erst Schlüssel ins Schloss stecken, dann umdrehen, danach Gas geben (wo? der Hebel rechts oder links?) , anschließend Kupplung treten und Gang einlegen... Und heute? Die richtige Abfolge beim Starten ist einem zur Gewohnheit geworden. Man macht automatisch all die Schritte, die man sich zuvor mühsam merken musste und hat den Kopf frei für anderes.
Das Übungsziel: Absehfähigkeit
So ähnlich verhält es sich auch mit dem Absehen. Man lernt Schritt für Schritt die Theorie, und das Ziel ist es, dass man die Verwechslungen „im Schlaf“ beherrscht. Man sieht dann nicht mehr ein [b], sondern einen Vertreter der „bilabialen Reihe“, alle Möglichkeiten sind einem präsent, sind als mögliche Lösungen verfügbar. Man legt sich nicht vorab auf eine Bedeutung fest, und das bedeutet eben auch, dass man nicht mehr auf einem Laut „sitzenbleibt“ und verzweifelt nach einem Wort mit [b] sucht, wenn der Gesprächspartner über den „Mann“ spricht. Man ergänzt im Idealfall den richtigen Laut, das [m], entsprechend dem Zusammenhang, in dem das Wort steht. Natürlich genügt es für diese Fertigkeit, die „Kombinationsfähigkeit“ genannt wird, nicht, die Theorie zu erlernen. Man kann noch nicht die Sprache vom Mund absehen, wenn man die Sache theoretisch beherrscht. Man muss das Gelernte auch anwenden können, und das erfordert Geduld und sehr viel Übung. Ein Lippenablesekurs sollte so aufgebaut sein, dass ein Schritt auf dem anderen aufbaut, dass die gut absehbaren Laute zunächst im Vordergrund stehen und man sich nach und nach übend an die schlecht bis gar nicht absehbaren Laute herantastet. Das bedeutet aber auch, dass das Lippenabsehen ein längerer Weg ist. Manchmal stellt sich ein spürbarer Erfolg erst nach zwei bis drei Jahren ein. Und man sollte sich die Theorie auch immer mal wieder vergegenwärtigen, wenn man den Kurs abgeschlossen hat, sonst verlernt man vieles auch wieder. Aber der Erfolg gibt den eigenen Anstrengungen praktisch recht. Jeder, der Hörprobleme hat, sollte das Absehen lernen, denn es ist das Mittel, Defizite beim Hören zu kompensieren, wo mechanische Hörhilfen nicht mehr weiterhelfen können.
Hören und Absehen – eine hilfreiche Kombination
Die Grundlage für den Zusammenhang verdeutlicht das unten abgebildete Schaubild. Es zeigt den engen Zusammenhang von Hören und Absehen, was die Zuordnung der Laute zum sichtbaren Bild und zum hörbaren Ton betrifft. In der Waagerechten sind die Laute aufgeführt, die beim Hören zu verwechseln sind, in der Senkrechten stehen die Laute, die beim Absehen verwechselt werden:
B - D - G
P - T - K
M - N - NG
Abb.: Das magische Quadrat
(Hanik/Diehl/Dechant)
So kann ein Schwerhöriger z. B. ein [m] von einem [n], zwei Laute, die sich für ihn gleich anhören, dann sicher unterscheiden, wenn er auf das Mundbild achtet. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in Sachen praktische Nützlichkeit : Die theoretischen Kenntnisse über Absehschwierigkeiten und Hörprobleme sind auch für nicht betroffene Mitmenschen, die häufig Umgang mit ihren hörgeschädigten Freunden oder Bekannten oder die gar beruflich mit Hörgeschädigten zu tun haben wie Lehrer oder Erzieher, ein probates Hilfsmittel. Was Hörende im Umgang mit Hörbehinderten wissen sollten: Es gibt eben Wörter und Sätze, die es demjenigen, der zumindest zum Teil auf das Absehen angewiesen ist, unnötig schwer machen. Da hilft die Spiegelprobe: Vergleicht man den Satz „Setzen Sie sich!“ mit dem Satz „Nehmen Sie bitte Platz“, fällt ein deutlicher Unterschied auf. Der erste Satz ist fast nicht absehbar, denn die Lippen öffnen sich fast nicht. Dagegen bietet der zweite Satz dem Absehenden gute Anhaltspunkte, besonders das Schlüsselwort „Platz“ ist relativ gut sichtbar. Wer diese „Kleinigkeiten“ bewusst anwendet, erleichtert dem hörbehinderten Partner die Kommunikation sehr. So ein praktischer Hinweis ist manchmal mehr wert als viele Plädoyers für mehr Verständnis. Er räumt nämlich einfach eine Barriere aus dem Weg, und das ist ein weiterer Schritt zum Miteinander von Hörenden und Hörgeschädigten.
3. Kapitel:
Das Geheimnis eines nachhaltigen Hörtrainings
Ob schleichende Hörminderung oder plötzliche Ertaubung aufgrund einer Operation an einem Akustikusneurinom – für NF2-Patienten ist ein Hörverlust absehbar und daher schon im Voraus mit einer großen seelischen Belastung verbunden. Eine einmal eingetretene Zerstörung des Hörnervs ist endgültig, es gibt (bislang) keine Möglichkeit für einen Ersatz. Ein Hüftgelenk kann man ersetzen, den Hörnerv leider nicht. In manchen Fällen gelingt es, die fehlende Schallleitung durch ein Implantat zu ersetzen, aber ein vollgültiger Ersatz, eine völlige Wiederherstellung des alten Hörvermögens gelingt damit nicht. Aber die noch vorhandenen Hörreste oder auch das mit dem Hörgerät oder dem Implantat neu dazu gewonnenen Hörvermögen lassen sich trainieren und damit entscheidend verbessern. Jeder Schwerhörige hat eine ganz individuelle Hörwahrnehmung Ein Hörtraining ist von Anfang bis Ende eine sehr individuelle Angelegenheit. Es gibt – anders als beim Absehen – keine objektive, das heißt für alle Lernenden gültige, in der Sache begründete Vorgehensweise. Damit ist gemeint, dass der Aufbau eines Lernprogramms der ganz individuellen Hörschädigung angepasst werden muss. Der HNO-Arzt wird in der Regel eine Hörkurve des Betroffenen erstellen, die bereits Aufschluss gibt, wo bzw. in welchen Tonhöhenbereichen die Probleme liegen, aber das Sprachverstehen ist damit nur sehr unzureichend erfasst. Die gängigen Sprachverständnistests hingegen geben zwar Aufschluss darüber, was der Getestete alles nicht versteht, und können das in einer durchschnittlichen Größe ausdrücken, sie helfen aber nicht weiter, wenn es darum geht heraus zu finden, was wie gehört und warum dieses oder jenes nicht oder falsch gehört wurde. Das ist aber entscheidend, wenn es um die Verbesserung des Hörvermögens geht. Von der Wahrnehmung irgendeines Lauts oder einer Lautverbindung bis hin zum Erkennen eines gesprochenen Worts oder eines sprachlichen Zusammenhangs ist es nämlich ein weiter Weg, und einen großen Teil dieses Wegs legt der Hörende buchstäblich „im Kopf“ zurück: Er hört nicht einfach, und dann hat er eine Abbildung des Gehörten im Kopf – sondern sein Hören ist weitgehend ein individueller Verarbeitungsprozess, der auf Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Zuordnung und Verarbeitung des Gehörten beruht. Entscheidend dabei ist auch die Fähigkeit, nicht oder unzureichend Gehörtes sinnvoll zu ergänzen.
Das Hören beruht immer schon auf einem Lernprozess
Das gilt für alles Gehörte und umfasst viel mehr als nur Sprache. Für die Sprache allerdings gilt die Erfahrung, die ein Hörender im Laufe seines Lebens ansammelt, in ganz besonderer Weise. Schon ein Kleinkind hört die Stimme der Mutter aus vielen Sprechern heraus, ohne ein einziges Wort zu verstehen. Es achtet auf ihre Worte und darauf, wie sie die Worte spricht und ausspricht. Eine stark schwerhörige Tochter kann nur mit ihrer Mutter telefonieren, deren sprachliche Eigenart ihr vertraut ist. Die Beispiele sollen deutlich machen, dass Hören und Hinhören gelernt werden, also auch nach einem Hörverlust neu gelernt werden können.
Eine lückenhafte Hörwahrnehmung ...
Die bestmögliche Wahrnehmung steht also am Anfang einer Hörkette – aber was ist, wenn ein Hörverlust schon da eine undurchdringliche Barriere bildet? Wenn durch einen Hörverlust einfach bestimmte Frequenzen bei aller Konzentration nicht wahrgenommen werden können und auch die Verstärkung durch eine Hörhilfe ihre Grenzen hat? Es ist nämlich eine vollkommen falsche Vorstellung, dass ein Hörgeschädigter alles zu leise hört und es deshalb darauf ankäme, lediglich die Lautstärke zu erhöhen. Laute Geräusche und lautes Sprechen sind nämlich für die meisten Menschen mit Hörproblemen viel unangenehmer als für ihre Mitmenschen. Ihre Empfindlichkeitsschwelle liegt häufig niedriger und lautere Töne werden als schmerzhaft empfunden. Deshalb wird die Sprache auch nicht besser verstanden, wenn der Sprecher laut spricht.
Hörgeschädigte nehmen die Sprache lückenhaft wahr: Sie hören in einzelnen Frequenzbereichen gut, in anderen schlecht oder überhaupt nicht. Da aber die Sprachlaute keine Sinustöne sind, wie die Töne, die einem beim Hörtest angeboten werden, sondern eine Zusammensetzung aus verschiedenen Frequenzen bilden, ist die Sache kompliziert. Jeder Laut hat bestimmte charakteristische Frequenzspitzen, und wenn der Frequenzausfall des Betroffenen in diesem Bereich liegt, kann er den Laut nicht identifizieren. Dennoch hört er unter Umständen etwas: die Unter- oder Obertöne, die sich um die Spitzen herum gruppieren, und die auch für ganz andere Laute charakteristisch sind. Hier setzt die Tätigkeit einer individuellen Hörtherapie an. Der Therapeut kann herausfinden und festhalten, was aktuell gehört wird, also wie der momentane Stand seines Patienten ist, wenn er mit dem Hörtraining beginnt. Diesen Stand genau zu ermitteln ist der Ausgangspunkt eines sinnvollen Übungsprogramms.
...kann überbrückt werden
Die Praxis Hanik in München hat zu diesem Zweck eine spezielle Hör-Lautuntersuchung entwickelt, in der nicht nur festgehalten wird, welche Laute und Lautgruppen der Patient hört, sondern wie er sie hört und mit welchen Lauten sie manchmal oder häufig oder immer verwechselt werden. Das erlaubt den Therapeuten eine genaue Diagnose über die spezielle Hörfähigkeit dieses Hörers im Allgemeinen und einzelner Laute im Besonderen zu stellen. So kann zusammen mit dem Patienten ein an ihn angepasster Hörübungsplan erstellt werden, Fortschritte können dokumentiert und mit dem Anfangsstand verglichen werden und vor allem wichtige Lautverwechslungen lassen sich in Angriff nehmen, um ein besseres Differenzierungsvermögen zu erreichen. Eine solche gezielte Übung ist in zweierlei Hinsicht hilfreich: Sie schult ein Unterscheidungshören, das zu einem tatsächlichen Hörerfolg führen kann, wenn der Patient beispielsweise mit ziemlicher Sicherheit ein [i] von einem [ü] unterscheiden lernt – aber auch wenn eine Unterscheidung nicht gelingt oder nur sehr bedingt, hat der Patient etwas ganz Entscheidendes gelernt: Er weiß jetzt, dass er ständig mit dieser Hör-Verwechslung rechnen muss, und kann sich darauf einstellen. So versteht er in der abendlichen Situation, dass sein Sohn schon im Bett liegt (und nicht lügt).
Der erste Schritt zu einer entspannteren Kommunikation
Für NF2-Betroffene gilt in besonderer Weise, was für alle Hörgeschädigten gilt: Eine Hörminderung, selbst ein geringes Restgehör, lässt sich mit Erfolg trainieren und damit deutlich verbessern. So kann zu einer gut ausgebildeten Absehfähigkeit ein verbessertes Hörvermögen hilfreich hinzutreten, und beides zusammen kann und sollte sich wechselseitig ergänzen und befördern. Die Kombinationsfähigkeit, die beim Absehen genauso wie beim Umgang mit den eigenen Hörverwechslungen erworben wird, ist dabei das A und O für ein besseres Verstehen der lautlichen Zusammenhänge und der damit ausgedrückten Bedeutungsinhalte. Dafür ist eine kombinierte Hörsprachtherapie ein Angebot. Sie ist individuell ausgerichtet und bietet dem Betroffenen Hilfe zur Selbsthilfe. Nicht in dem Sinn, dass sich der NF2-Betroffene eben selbst anstrengen soll, wenn er etwas verstehen will, sondern als gemeinsames Herausfinden eigener Stärken, die das Leben erleichtern, wenn sie bewusst eingesetzt werden. Außerdem ist eine so aufgebaute Hörsprachtherapie überhaupt keine trockene Angelegenheit. Es macht durchaus auch Spaß, die eigenen „Absehrätsel“ zu lösen und neue Höraufgaben erfolgreich zu bewältigen. Was aber wirklich zählt, ist neben dem messbaren Erfolg das eigene Erfolgserlebnis in der Kommunikation.
Kontakt:
Praxis Roland Hanik
Fürstenriederstraße 35
80686 München
Telefon: 089-561696
Fax: 089-584469
Bildtelefon: 089-56822780
www.praxis-fuer-hoergeschaedigte.de
info@praxis-fuer-hoergeschaedigte.de




 Abbildung: Schematische Darstellung der Tonhöhenrepräsentation (Tonotopie) im Nucleus cochlearis. Oberflächenelektroden (rechts) können Tonhöhenunterschiede nur durch die variable Ausprägung des elektrischen Feldes erzeugen. Mit Insertionselektroden (INSEL, links) können Regionen innerhalb des Hörkerns, die unterschiedliche Frequenzen repräsentieren, direkt stimuliert werden. (modifiziert nach Rauschecker & Shannon, Science, 2002)
Abbildung: Schematische Darstellung der Tonhöhenrepräsentation (Tonotopie) im Nucleus cochlearis. Oberflächenelektroden (rechts) können Tonhöhenunterschiede nur durch die variable Ausprägung des elektrischen Feldes erzeugen. Mit Insertionselektroden (INSEL, links) können Regionen innerhalb des Hörkerns, die unterschiedliche Frequenzen repräsentieren, direkt stimuliert werden. (modifiziert nach Rauschecker & Shannon, Science, 2002) erstörten Nucleus cochlearis.
erstörten Nucleus cochlearis. mt stark von der Implantatposition im Mittelhirn ab.
mt stark von der Implantatposition im Mittelhirn ab.